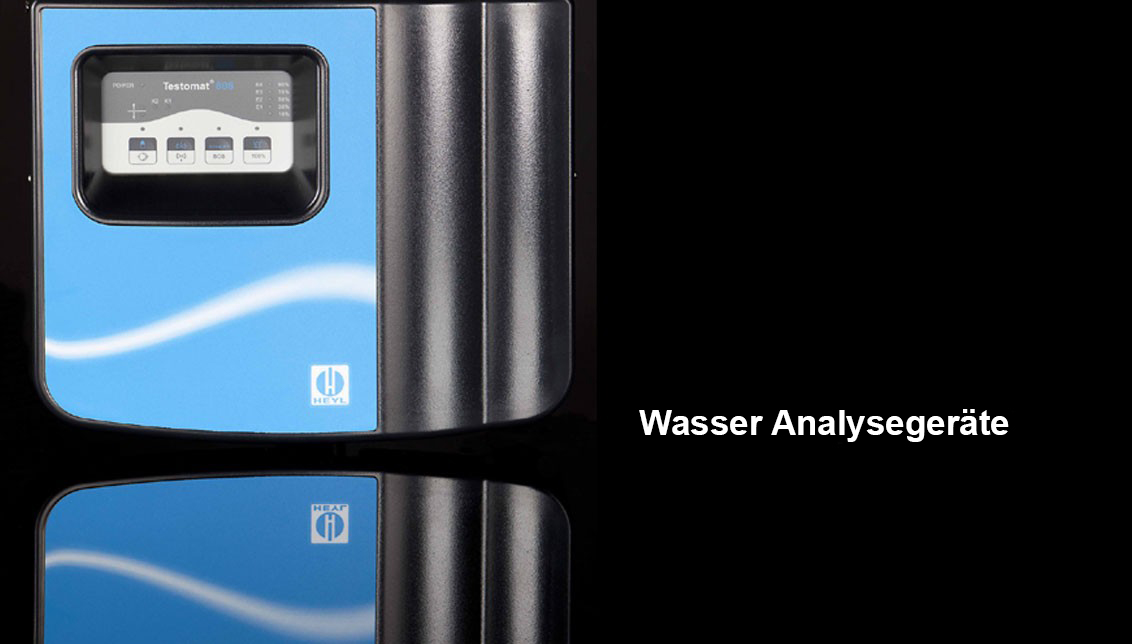Der Online Analysator TESTOMAT®
Einsatz für die Wasserhärte - Bestimmung
Die Härte des Wassers entsteht durch gelöste Salze. In natürlichen Wässern bildet sich die Härte vor allem aus Magnesium- und Calciumhydrogencarbonat und -sulfat, welche aus dem Boden und / oder Grundwasserleitern gelöst wurden. Das Wasser wird umso härter, je mehr Salze im Wasser gelöst sind.
Da die Beschaffenheit des geologischen Untergrunds regional sehr unterschiedlich ist, sind in der Praxis verschiedenste Wasserhärten und Zusammensetzungen anzutreffen.
Magnesium- und Calciumionen können beispielsweise durch einfache Löseprozesse in das Wasser gelangen, wie z.B. durch Auflösungen von Gips.
Der überwiegende Teil der Wasserhärte entsteht jedoch als Carbonathärte durch Auflösung von Kalk (CaCO3) bzw. Dolomit (Ca-Mg-Mischcarbonat) durch Kohlensäure unter Bildung löslicher Hydrogencarbonate (HCO3−). Das CO2 stammt überwiegend aus dem Boden, wo der mikrobielle Abbau organischer Substanz zu erhöhten CO2-Konzentrationen führt.
Weitere Eintragswege sind unter anderem das Herauslösen durch saure Komponenten des Niederschlags oder aber durch Salpetersäure aus der Nitrifikation im Ergebnis landwirtschaftlicher Düngung.
Im technischen Zusammenhang werden unterschiedlichste Begrifflichkeiten verwendet um die spezifischen Eigenschaften des Wassers als messtechnische Größe abzubilden.
Die Gesamthärte ist definiert als die Summe aller Erdalkali-Ionen; dies sind v.a. Calcium und Magnesium. In Lösung sind diese "gepaart" mit Chloriden, Sulfaten, Carbonaten und anderen Anionen.
Die bekannteste und genaueste Bestimmungsmethode für die Gesamthärte ist die komplexometrische Titration mit einer wässrigen Lösung des Dinatriumsalz der Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA, Handelsname: Titriplex III) mit bekannter Konzentration.
EDTA bildet mit den Härtebildnern Ca2+ und Mg2+ lösliche, stabile Chelatkomplexe. Die zu untersuchenden Wasserprobe wird mit 25%-iger Ammoniaklösung, einem pH 11 Puffer (Ammoniak-Ammoniumacetat) und dem Indikator Eriochromschwarz-T versetzt. Der Indikator bildet mit den Ca2+ und Mg2+ einen rot gefärbten Komplex. Sind diese Ionen am Ende der Titration vom EDTA gebunden, liegt das Eriochromschwarz-T frei vor und ist grün gefärbt.
Die Gesamthärte berechnet sich aus den verbrauchten ml EDTA-Lösung. Hierdurch ist eine hoch genau IST-Wert Analyse möglich.
Bei Messgeräten zur Grenzwertüberwachung wird dieses Reaktionsverhalten durch die Zugabe einer fest definierten Menge Indikator, welcher von der chemischen Formulierung auf ein spezifisches Aufnahmevermögen an Ca2+ und Mg2+ ausgelegt ist, genutzt. Wird durch die dosierte Menge ein Überschuss an Eriochromschwarz-T der Wasserprobe zugeführt, behält diese eine grüne Färbung. Umgekehrt gilt, dass sofern die Konzentration an Ca2+ und Mg2+ höher ist als die Menge, die durch die zugeführte Menge an Eriochromschwarz-T gebunden werden kann, dass Wasser eine rote Farbe beibehält.
Messgeräte |
|
Testomat® ECO und Testomat® ECO Plus Testomat LAB TH und Testomat LAB TH-R Testomat® 808 (Grenzwertmessgerät) |
Die Säurekapazität ist ein Maß für die Pufferkapazität (pH-Wert-Stabilität) des Wassers gegenüber Säuren. Sie ist ein Maß für die Pufferkapazität des Wassers. In der Praxis werden hierbei die beiden nachstehenden Säurekapazitäten für die Umsetzung von verfahrenstechnischen Prozessen herangezogen.
In Bezug auf die Wasserhärte ist die Konzentration des Anions Hydrogencarbonat (HCO3−) von besonderer Bedeutung. Man bezeichnet diese Konzentration als Carbonathärte, temporäre Härte, vorübergehende Härte, m-Wert oder Säurekapazität bis zu einem pH-Wert von 4,3 (KS 4,3). Die Bezeichnung m-Wert basiert hierbei auf dem Einsatz des Indikators Methylorange, welcher seinen Umschlagspunkt bei einem pH-Wert von 4,3 hat.
Ein Wasser befindet sich im sogenannten Kalkkohlensäure-Gleichgewicht, wenn es gerade so viel Kohlenstoffdioxid, enthält, dass es gerade keinen Kalk abscheidet aber auch keinen Kalk lösen kann. Wird einem solchen Wasser Kohlenstoffdioxid entzogen, bilden sich schwer lösliche Verbindungen wie Calcit und Dolomit als besonders schwer lösliches Mischcarbonat (Kesselstein). Dies hängt von dem komplexen temperaturabhängigen Calciumcarbonat-Kohlensäure-Kohlenstoffdioxid-Gleichgewicht ab. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit dieses Gleichgewichtssystems bilden sich auch Ablagerungen bei der Bereitung von Heißwasser (Warmwasseranlagen, Kaffeemaschinen, Kochtöpfe) und bei Verfahren zur Herstellung von industriell genutztem Dampf.
Die Bestimmung der Carbonathärte (m-Wert, KS 4,3) erfolgt durch die Ermittlung des Salzsäure-Bindungs-Vermögens. Hierzu wird eine definierte Menge Wasserprobe mit Salzsäure (c = 0,1 mol/l) bis zum pH-Wert 4,3 titriert. Durch Verwendung des Indikators Methylorange, ist hierdurch eine hoch genaue Bestimmung möglich. Der Säureverbrauch in ml entspricht hierbei der Hydrogencarbonatkonzentration in mval/l. Die Multiplikation mit 2,8 ergibt deutsche Härtegrade (°dH).
Messgeräte |
Die „Säurekapazität (KS) bis pH 8,2" (p-Wert, KS 8,2) erfasst alle alkalischen Bestandteile des Wassers, die Hydroxid-Ionen bilden, wie freie Basen, sowie die ersten Hydrolysestufen der Alkali- und Erdalkalisalze schwacher, mehrwertiger Säuren (z.B. Karbonate, Phosphate, Silicate). Die Bezeichnung p-Wert basiert hierbei auf der Verwendung des Indikators Phenolphtalein. Sie gibt an, wieviel Säure eine Wasserprobe bis zum Umschlagpunkt des Indikators Phenolphthalein (pH 8,2) aufnimmt.
Die Bestimmung der (p-Wert, KS 8,2) erfolgt durch die Ermittlung des Salzsäure-Bindungs-Vermögens bis zum pH-Wert 8,2 Hierzu wird eine definierte Menge Wasserprobe mit Salzsäure (c = 0,1 mol/l) bis zum pH-Wert 8,2 titriert. Durch Verwendung des Indikators Phenolphtalein, ist hierdurch eine hoch genaue Bestimmung möglich. Der Säureverbrauch in ml entspricht hierbei der Hydrogencarbonatkonzentration in mval/l. Die Multiplikation mit 2,8 ergibt deutsche Härtegrade (°dH).
Messgeräte |